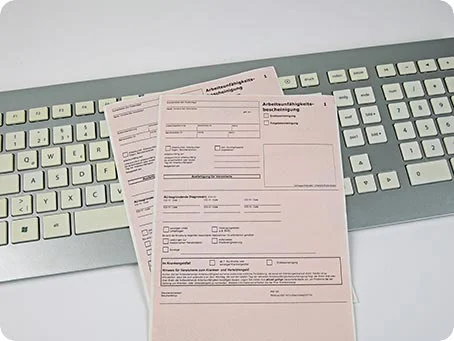Cannabis-Jahresrückblick 2024: Was bewegte Patienten und Anwender?

Veröffentlicht am: 13.12.2024
Key Facts
- Legalisierung und Freizeitkonsum: Das neue Cannabisgesetz (CanG) erlaubt seit dem 1. April 2024 den Besitz von 25 g und Anbau von bis zu 3 Pflanzen für den Eigenbedarf.
- Medizinisches Cannabis: Der Wegfall des Genehmigungsvorbehalts erleichtert die Verschreibung für chronisch kranke Patient:innen.
- Digitalisierung: Neue Telemedizin-Plattformen bieten einfachen Zugang und schnelle Rezeptausstellung für medizinisches Cannabis.
- Gesellschaftliche Akzeptanz und Aufklärung: Diverse Bildungsinitiativen fördern Wissen zur Einnahme und zu gesundheitlichen Auswirkungen der Cannabistherapie.
- Versorgung und Herausforderungen: Aufgrund der hohen Nachfrage kam es zu Lieferengpässen nach medizinischem und freizeitlichem Cannabis.
- Forschung und Nachhaltigkeit: Nachhaltige Anbaumethoden und vor allem medizinische Studien bleiben zentrale Zukunftsthemen.
Das Jahr 2024 war für die Cannabisbranche in Deutschland äußerst dynamisch und prägend. Von der Legalisierung für Freizeitkonsum bis zu Reformen in der medizinischen Versorgung hat sich viel bewegt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen:
Legalisierung von Cannabis für den Freizeitgebrauch
Am 1. April 2024 trat das Cannabisgesetz (CanG) in Kraft. Erwachsene dürfen nun:
- Bis zu 25 Gramm Cannabis außerhalb der Wohnung besitzen.
- Drei Pflanzen zu Hause anbauen (für den Eigenbedarf).
- Mitglieder von Cannabis-Clubs werden, um gemeinsam anzubauen.
Parallel dazu wurde das MedCanG (Medizinisches Cannabis-Gesetz) überarbeitet, um die medizinische Versorgung weiter zu stärken. Neben der Legalisierung des Freizeitkonsums wurden die Rahmenbedingungen für Patient:innen präzisiert:
- Verbesserte Versorgungssicherheit: Der Anbau und die Produktion von medizinischem Cannabis wurden in Deutschland ausgebaut, um Lieferengpässe zu minimieren.
- Flexiblere Verschreibungsmöglichkeiten: Aufgrund der Entnahme aus dem Betäubungsmittel-Status wurde die Verordnung von medizinischem Cannabis vereinfacht. Ohne den BtM-Status entfällt die Stigmatisierung von Cannabis als „letztes Mittel“.
- Standardisierung der Qualität: Strengere Vorgaben für die Reinheit und Dosierbarkeit der Produkte wurden eingeführt, um eine verlässliche medizinische Wirkung sicherzustellen.
Diese parallelen Entwicklungen sorgten für Erleichterungen und eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz, während gleichzeitig Bedenken über die mögliche Konkurrenz zwischen Freizeit- und medizinischem Markt laut wurden.
Es wurden weiterhin strenge Grenzen für Handel und Konsum in der Öffentlichkeit gesetzt. Erleichterungen bzw. Privilegien, wie bspw. beim Grenzwert im Rahmen von Verkehrskontrollen, gelten lediglich für Cannabis-Patient:innen und stärken somit deren Status. Diese Veränderung könnte die Nutzung von Cannabis als Medizin langfristig weiter normalisieren und etablieren.
Lockerungen beim Genehmigungsvorbehalt in der medizinischen Versorgung
Eine der zentralen Reformen war die Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), den Genehmigungsvorbehalt bei der Verschreibung von medizinischem Cannabis zu lockern. Ärzt:innen bestimmter Fachrichtungen, wie Schmerzmedizin oder Onkologie, können Cannabis nun ohne vorherige Genehmigung der Krankenkassen verordnen.
Diese Änderung erleichtert den Zugang für viele Patient:innen insbesondere für diejenigen mit chronischen Schmerzen, Epilepsie oder Krebs. Zudem wurde die Wartezeit reduziert und bürokratische Hürden erheblich abgebaut. Dennoch blieben weitere Herausforderungen bestehen:
- Kostenübernahme: Viele Krankenkassen verweigerten weiterhin die Erstattung, insbesondere bei neuen oder weniger erforschten Indikationen.
- Unterschiedliche Versorgungsqualität: Die Verfügbarkeit von spezialisierten, erfahrenen Ärzt:innen variierte stark je nach Region.
Auch mit dem Wegfall des Genehmigungsvorbehaltes bleibt eine sorgfältige Abwägung der Indikation durch den Arzt bzw. die Ärztin notwendig sowie die allgemeinen Richtlinien zur Cannabistherapie bestehen.
Digitalisierung in der Medizin: Neue Angebote in Form von Telemedizin-Plattformen
Parallel zur teils unzureichenden regionalen Versorgung stieg die Nutzung von Telemedizin 2024 deutlich an. Online-Plattformen ermöglichten Patient:innen von zu Hause aus medizinisches Cannabis zu beantragen. Vorteile:
- Bequemer Zugang zu spezialisierten Ärzt:innen
- Schnelle Rezeptausstellung, insbesondere für chronische Patient:innen
Allerdings warfen diese Entwicklungen auch Fragen zur Qualität der Behandlung und möglichen Missbrauchsmöglichkeiten auf. Regulierungsbehörden verstärkten die Überwachung von Telekliniken, um sicherzustellen, dass Verschreibungen korrekt ausgestellt wurden. Hier ist es insbesondere wichtig, einen genauen Blick auf die jeweilige Teleklinik zu werfen: Der Mensch neigt mitunter dazu, ein vorschnelles und verallgemeinertes Urteil über die Verschreibungspraxis mancher Anbieter zu fällen -- zum Nachteil „echter“ Betroffener.
Aufklärung und gesellschaftliche Akzeptanz
Die Legalisierung brachte eine breitere Diskussion über den verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis mit sich. Freizeitkonsument:innen und Patient:innen wurden zunehmend in öffentliche Bildungsinitiativen eingebunden, um über Themen wie:
- Konsummuster und Sicherheit (z. B. Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit),
- langfristige Gesundheitseffekte,
- mögliche Abhängigkeit zu informieren.
Besonders positiv: Viele Patient:innen berichteten von einer Entstigmatisierung ihres Cannabisgebrauchs, was es ihnen erleichterte, über ihre Erfahrungen zu sprechen und Unterstützung zu finden.
Herausforderungen in der Versorgung
Trotz aller Fortschritte gab es weiterhin Probleme:
- Lieferengpässe: Besonders nach der Legalisierung kam es vorübergehend zu Versorgungsengpässen, da die Nachfrage nach Cannabis sowohl im Freizeit- als auch im medizinischen Bereich stark anstieg.
- Uneinheitliche Qualität: Patient:innen berichteten von Schwankungen in der Wirkstoffkonzentration, was die Therapie erschwerte.
- Kostenfrage: Selbstzahler:innen sahen sich mit steigenden Preisen konfrontiert, da die Nachfrage das Angebot zeitweise überstieg.
Ausblick: Nachhaltigkeit und Forschung
Die Branche investiert zunehmend in nachhaltige Anbaumethoden und innovative Produkte sowie neue Darreichungsformen. Gleichzeitig bleibt die medizinische Forschung ein Schwerpunkt, insbesondere in Bereichen wie Schmerztherapie, Epilepsie und psychischen Erkrankungen.
2024 war ein entscheidendes Jahr für die Normalisierung von Cannabis in Deutschland. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Veränderungen entfalten.
Fazit
Das Jahr 2024 markierte eine neue Ära für Cannabis-Nutzer:innen in Deutschland. Die Legalisierung und die Reformen im medizinischen Bereich verbesserten den Zugang und die gesellschaftliche Akzeptanz erheblich. Gleichzeitig blieben Herausforderungen bestehen, insbesondere in der Qualitätssicherung und der Kostenübernahme. Für 2025 bleibt die Frage spannend, wie sich diese Dynamiken weiterentwickeln werden.