Cannabis – Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
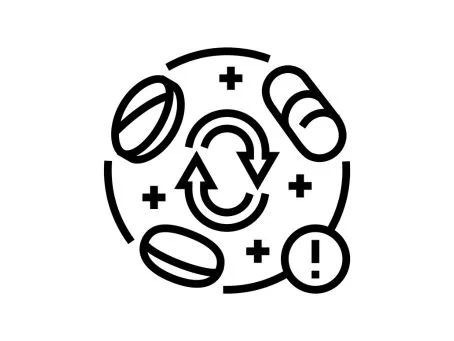
Aktualisiert am: 23.07.2025
Cannabis kann in der medizinischen Anwendung vielfältige therapeutische Effekte erzielen – etwa bei Schmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit oder Erbrechen. Doch ebenso relevant sind die potenziellen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, insbesondere im Hinblick auf die Wirkung, Verstärkung, Abschwächung oder unerwünschte Nebenwirkungen. Eine sorgfältige Einschätzung ist sowohl bei der Therapie mit Medizinalcannabis als auch beim Freizeitkonsum notwendig.
Cannabis-Wechselwirkungen mit Medikamenten – ein Überblick
Cannabis ist kein Reinstoff, sondern ein komplexes Vielstoffgemisch. Neben dem psychoaktiven Tetrahydrocannabinol (THC) und dem nicht-psychoaktiven Cannabidiol (CBD) enthält es weitere Cannabinoide wie Cannabinol (CBN) oder Cannabigerol (CBG) sowie sekundäre Pflanzenstoffe wie Terpene und Flavonoide. Diese Substanzen liegen je nach Cannabissorte in unterschiedlichen Konzentrationen vor, was die Interaktionen mit anderen Arzneimitteln unvorhersehbar macht.
Pharmakologische Grundlagen der Cannabis-Wechselwirkungen
Einige Bestandteile von Cannabis können andere Substanzen aus ihrer Bindung an Rezeptoren verdrängen, was zu erhöhten Wirkstoffkonzentrationen im Blut führt. Dies ist besonders kritisch bei Medikamenten mit hoher Plasma-Protein-Bindung wie etwa THC (95–99 %).1 Diese Verdrängung kann zu einer verlängerten Wirkung und verstärkten Nebenwirkungen führen.
Zudem wird Cannabis über die Leber und das Cytochrom-P450-Enzymsystem abgebaut.2 Insbesondere die Enzyme CYP3A4, CYP2D6 und CYP2C9 spielen eine zentrale Rolle. Werden diese durch THC und CBD blockiert, kann es zu erhöhten Wirkspiegeln anderer Arzneistoffe kommen oder die Wirksamkeit bestimmter Prodrugs vermindert werden.
Verstärkte Wirkung von Medikamenten durch Cannabis
Cannabinoide können die Wirkung mancher Arzneimittel verstärken, wodurch es vermehrt zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen kann. Nachfolgend sind diese (nicht vollständig) aufgeführt:
Die gleichzeitige Einnahme von Cannabis und Beruhigungs- oder Schlafmitteln kann, aufgrund ähnlicher pharmakologischer Wirkung, die Effekte beider Arzneimittel verstärken. Dabei kann es vermehrt zu Benommenheit und Schwindel kommen. Muskelrelaxierende Arzneimittel zeigen eine ähnliche Wirkung, wodurch es bei der Einnahme zusammen mit Cannabis zu einem erhöhten Sturzrisiko kommt. Generell ist bei gemeinsamer Einnahme von Cannabinoiden und Sedativa oder Hypnotika Vorsicht geboten, da es auch in diesem Falle zu additiven Wirkungen kommen kann.
Medizinalcannabis wechselwirkt mit verschiedenen Arzneimitteln, die auf das Herz-Kreislauf-System wirken. In einer Studie von Jadoon et al. wurde gezeigt, dass die Einnahme von Cannabis mit einer Senkung des Blutdruckes bei gesunden Probanden einherging.3 In diesem Zusammenhang ist insbesondere bei der gleichzeitigen Einnahme von Cannabis-basierten Präparaten und Blutdruckmedikamenten Vorsicht geboten. Ebenso ist bei Antikoagulanzien (DOAK) wie Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban ein Einfluss der Cannabinoide denkbar. Die Blutgerinnungshemmer sind Substrate des Transporters p-Glykoprotein (Pgp), welcher durch die Cannabinoide inhibiert wird. Das kann in einer erhöhten Bioverfügbarkeit der DOAK resultieren, was unter anderem zu anhaltenden Blutungen und Blutergüssen führen kann.
Insbesondere THC kann die Wirkung von Antidepressiva wie den selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) Fluoxetin, Paroxetin oder Sertralin verstärken. Im Falle der trizyklischen Antidepressiva wie Amitriptylin kann es aufgrund der Cannabiseinnahme zu einer Verstärkung der tachykarden und sedativen Wirkung kommen.4
Es wird vermutet, dass THC die antipsychotische Wirkung von Arzneimitteln hemmen und auf der anderen Seite die durch Neuroleptika ausgelösten Bewegungsstörungen reduzieren kann.5
Cannabisbasierte Arzneimittel zeigen eine gute antiemetische (brechreizhemmende) Wirkung im Rahmen einer Zytostatika-Behandlung. Sind CYP-Enzyme am Abbau des Krebsmedikaments beteiligt, führt eine Hemmung der CYP-Enzyme durch Cannabis zu einer Steigerung der Plasmaspiegel der Wirkstoffe8. Dadurch ist andererseits eine stärkere Ausprägung der Nebenwirkungen denkbar.6 Eine umfangreiche Übersicht über die Wechselwirkungen zwischen Cannabinoiden und Zytostatika liefern Bouquie et al.10.7
Ebenso wie der Abbau der Zytostatika kann auch der Abbau anderer Medikamente, die über das CYP2C19 abgebaut werden, gehemmt sein. Dazu zählen beispielsweise das Pantoprazol und Clobazam. Durch den verlangsamten Abbau zeigen diese Wirkstoffe eine längere Bioverfügbarkeit. Dadurch kann die Wirkung der Benzodiazepine verlängert sein, insbesondere die antiepileptische Wirkung.5
Die augeninnendrucksenkende Wirkung von Glaukom-Medikamenten kann bei zusätzlicher Einnahme von Cannabis aufgrund deren additiven Wirkung verstärkt sein.5
Synergistische Effekte: Gewünschte Kombinationen mit Cannabis
Manche Wechselwirkungen zwischen Cannabis und Begleitmedikamenten sind durchaus erwünscht.8 Dies ist dann der Fall, wenn beide Substanzen zusammen eine stärkere Wirkung hervorrufen, als sie es getrennt eingenommen tun würden. Man spricht in diesem Zusammenhang von Synergie-Effekten.
Beispielsweise kann medizinisches Cannabis aufgrund seiner antibakteriellen Effekte die Wirkung von Antibiotika unterstützen. Ähnliches wurde bereits bei der Kombination von Medizinalcannabis und Schmerzmitteln beobachtet. So wurde in einer Studie gezeigt, dass Cannabis die analgetische Wirkung von Opioiden verstärkt.9 Die Wirkweise der Schmerzmedikamente ist jedoch unterschiedlich, so dass zu Synergie-Effekten mit einzelnen Schmerzmedikamenten individuelle Studien notwendig sind.
Verminderte Wirksamkeit durch Cannabis
Bei gleichzeitiger Einnahme mit Cannabis kann es jedoch auch zu einer verringerten Wirkung der Medikamente kommen:
In einer Studie wurde beschrieben, dass die Wirkung von Warfarin bei gleichzeitiger Einnahme mit Cannabis verringert war.10 Daher wird die Einnahme von Cannabis und Vitamin-K-Antagonisten wie Phenprocoumon (Marcumar® und Generika) nicht empfohlen. Das Blutungsrisiko kann steigen, da THC und CBD das Enzym CYP2C9 hemmen, über das die Gerinnungshemmer metabolisiert werden.1
Ebenso hemmt Cannabis die Umwandlung von Clopidogrel in seinen aktiven Metaboliten, wodurch dessen antithrombotische Wirkung verringert sein kann.1 Es wird vermutet, dass Cannabis die Plasmaspiegel von Metformin, welches zur Senkung des Blutzuckers eingesetzt wird, verringert.11 Dafür gibt es jedoch aktuell keine hinreichenden Belege.
Umgekehrte Effekte: Medikamente beeinflussen die Cannabiswirkung
Neben den bereits beschriebenen Effekten von Cannabis auf die Pharmakologie anderer Arzneimittel, sind auch gegenteilige Wechselwirkungen möglich.
CYP3A4-Inhibitoren wie Verapamil, Ketoconazol, Itraconazol, Clarithromycin, Ritonavir oder Makrolidantibiotika könnten die psychoaktiven Effekte von THC verstärken, indem sie dessen Abbau verlangsamen.12 Demgegenüber gibt es auch Medikamente, die die Aktivität des CYP3A4-Enzyms erhöhen, bspw. Rifampicin, Carbamazepin und Phenytoin, und somit auch die Metabolisierung von CBD und THC beschleunigen. In diesem Zusammenhang sollte auch auf die Einnahme von Johanniskraut verzichtet werden, da dieses ebenfalls CYP3A4 aktiviert.12
Analog könnten auch potente CYP2C9-Inhibitoren wie Fluconazol, Cotrimoxazol, Fluoxetin oder Amiodaron bei gleichzeitiger Anwendung mit Cannabis die Exposition gegenüber THC, CBD und dessen Metaboliten erhöhen.12
Anticholinergika, wie Atropin und Scopolamin, und Barbiturate können die tachykarden THC-Effekte verstärken. Demgegenüber vermindern Betablocker die THC-assoziierte Herzfrequenzsteigerung.13
Prochlorperazin und andere Phenothiazine vermindern den psychotropen Effekt von THC und verstärken auf der anderen Seite den brechreizhemmenden Effekt.5
Sollte Cannabis durch Rauchen eingenommen werden, entstehen durch den Verbrennungsprozess, ebenso wie beim Rauchen einer Zigarette, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die die Bildung von CYP1A2 induzieren. Dieser Effekt tritt bereits bei zweimaligem Rauchen pro Woche auf. CYP1A2 ist an der Metabolisierung verschiedener Arzneistoffe wie Theophyllin, Agomelatin, Clomipramin, Imipramin, Olanzapin, Clozapin, Zolmitriptan, Duloxetin oder Clopidogrel beteiligt. Steht mehr Enzym zur Verfügung, erhöht das deren Abbau und vermindert so deren Wirkung.1
Fazit zur Cannabistherapie
Die Cannabistherapie sollte immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen – insbesondere bei Patienten mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, psychiatrischen Leiden oder bestehender Polymedikation. Eine sorgfältige Anamnese sowie schrittweise Dosisanpassung helfen, Kontraindikationen und Risiken zu minimieren.
Für Apotheker, Ärztinnen und andere Fachpersonen ist es essenziell, über die potenziellen Wechselwirkungen und Funktionen der beteiligten Stoffe informiert zu sein. Patienten sollten stets ihre gesamte Medikation, einschließlich freiverkäuflicher Präparate und Nahrungsergänzungsmittel, offenlegen.
Quellen:
[1] https://www.pharmazeutische-zeitung.de/cannabis-als-interaktionspartner-130661/
[2] Arzneimittelinteraktionen Prinzipien, Beispiele und klinische Folgen Drug interactions Dtsch Arztebl Int 2012; 109(33-34): 546-56.
[3] Jadoon KA, Tan GD, O'Sullivan SE. A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight. 2017 Jun 15;2(12):e93760.
[4] https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-412013/erkennen-erklaeren-ersetzen/
[5] Müller-Vahl, K. und Grotenhermen, F. (2020). Cannabis und Cannabinoide in der Medizin. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin, 120-126.
[6] Parihar, V., Rogers, A., Blain, A. M., Zacharias, S. R. K., Patterson, L. L., & Siyam, M. A. (2022). Reduction in Tamoxifen Metabolites Endoxifen and N-desmethyltamoxifen With Chronic Administration of Low Dose Cannabidiol: A CYP3A4 and CYP2D6 Drug Interaction. Journal of pharmacy practice, 35(2), 322–326.
[7] Bouquié, R., Deslandes, G., Mazaré, H., Cogné, M., Mahé, J., Grégoire, M., & Jolliet, P. (2018). Cannabis and anticancer drugs: societal usage and expected pharmacological interactions - a review. Fundamental & clinical pharmacology, 32(5), 462–484.
[8] Nielsen, S., Sabioni, P., Trigo, J. M., Ware, M. A., Betz-Stablein, B. D., Murnion, B., Lintzeris, N., Khor, K. E., Farrell, M., Smith, A., & Le Foll, B. (2017). Opioid-Sparing Effect of Cannabinoids: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 42(9), 1752–1765.
[9] Abrams, D. I., Couey, P., Shade, S. B., Kelly, M. E., & Benowitz, N. L. (2011). Cannabinoid-opioid interaction in chronic pain. Clinical pharmacology and therapeutics, 90(6), 844–851.
[10] Damkier, P., Lassen, D., Christensen, M. M. H., Madsen, K. G., Hellfritzsch, M., & Pottegård, A. (2019). Interaction between warfarin and cannabis. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 124(1), 28–31.
[11] Frisher M, White S, Varbiro G, et al. The Role of Cannabis and Cannabinoids in Diabetes. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2010;10(6):267-273.
[12] Arzneimitteltherapiesicherheit: Das Interaktionspotenzial der Cannabinoide Dtsch Arztebl 2018; 115(47): [28]; DOI: 10.3238/PersOnko.2018.11.23.05 Petri, Holger.
[13] Grotenhermen F. Praktische Hinweise. In: Grotenhermen F (Hrsg.): Cannabis und Cannabinoide. Pharmakologie, Toxikologie und therapeutisches Potential. Huber, Bern 2001.






